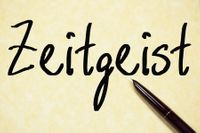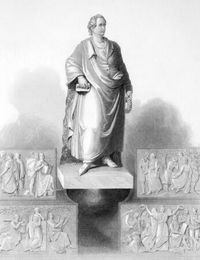Politik - Glaube - Philosophie
Liebe Besucher,
erfahren Sie im Folgenden mehr über meine politischen Positionen.
Herzliche Grüße
Dennis Riehle
Dennis Riehle verlässt nach 20 Jahren das linksgrüne Lager
Die Politik der Ampel-Koalition hat mich zum Umdenken bewegt!
Meine politischen Standpunkte
Um meine politische Verortung etwas besser kennenzulernen, drei Einlassungen von mir aus der Zeit der Ampel-Regierung, die mich zu einem grundlegenden Umdenken bewegte:
Die Polarisierung zerstört unsere politische Mitte!
Die derzeitige Polarisierung in unserer Gesellschaft zwischen Rechts und Links führt einerseits zu einer Schwächung der Mitte, andererseits aber auch zur Chance, diese wieder neu aufzubauen und wertzuschätzen. Mittlerweile gelten diejenigen, die sich nicht mehr in das Schwarz-Weiß-Raster einordnen lassen, als eine zerriebene Verschubware, die man im Zweifel gegen ihren Willen in eine der von Menschen guten Glaubens - aber ohne guten Willen - definierten Kategorien einsortiert. Wer nicht auf der richtigen Seite der Geschichte steht, steht auf der falschen. Diese Automatismen werden aktuell insbesondere durch diejenige Bevölkerungsklientel gepusht, die mit Vehemenz darauf drängt, dass sich der verantwortungsvolle Bürger von Weltoffenheit jenseits oder diesseits der sogenannten Brandmauer positioniert - welche in einer Demokratie so unnötig ist wie ein Kropf. Die durch die Regierung geförderte Aufwiegelung und Aufstachelung einer gesamten Republik findet nur wenige Vergleiche in der neueren Vergangenheit. Selbst in der DDR ging der Aufstand des Volkes nicht von den Diktatoren aus, sondern von der Basis. Vergleiche hierzu verbieten sich aber auch schon deshalb, weil heute nicht mehr für die Freiheit gekämpft wird, sondern für eine Einschränkung derselben.
Es bedarf im Augenblick viel Kraft, sich nicht vereinnahmen zu lassen von jenen, die partout darauf drängen, sich entscheiden zu müssen. Und so zeigt der Blick auf die Historie auch, dass es stets die Vermittler von Vernunft und Pragmatismus waren, die aus den festgefahrenen Konflikten herausgeführt haben. Dialogbereitschaft statt Abschottung, Zuhören statt Brandmarken, Verstehen statt Verachten. Eigentlich könnten die Prinzipien der unserer Grundordnung so leicht verständlich sein, würden sie nicht von denjenigen kleingeredet, die an einem Prozess der Befriedung kein Interesse haben. Immerhin müsste man sich im Zweifel des eigenen Versagens bewusst werden, Versäumnisse eingestehen und Besserung geloben. Doch Einsichtsfähigkeit ist in diesen Tagen genauso rar wie die Bereitschaft, die Scheuklappen abzulegen und sich bei klarem Verstand und mit reflektierendem Weitblick den fatalen Irrweg klarzuwerden, den Deutschland als über die eigenen Grenzen isolierter und international belächelter Außenseiter eingeschlagen hat. Eine weitere Spaltung unserer Nation verschärft den identitäts- und kulturpolitischen Kampf um die Deutungshoheit des Zustandes der Republik. Für Robert Habeck ist die Lage nicht dramatisch, es sind ja lediglich die Zahlen. Und so versucht man uns zu suggerieren, zu implementieren und weiszumachen, dass es nebenbei der hohe Krankenstand sei, welcher das ökonomische Übel verursacht.
Um gerade diesem irrwitzigen Informationsmonopol entgegenzutreten, braucht es die Wachheit von nicht-systemkonformen Parteien und Medien, die es zumindest vermögen, dass nicht noch weitere Bürger an den Dornröschenschlaf verloren gehen. Denn obwohl man eigentlich davon ausgehen sollte, dass wir aus den zwei Autokratien des vergangenen Jahrhunderts gelernt haben sollten, ist die die Naivität und Blauäugigkeit in unserem Land auf einem erschreckenden Vormarsch. Deshalb steigt auch die Anfälligkeit, sich von Onkel Robert Geschichten vorlesen zu lassen, um sich später in seiner Traumwelt der lebensfeindlichen Klimaneutralität, zwischen Wärmepumpen und E-Autos, zwischen Windrädern und Solarpanelen, zwischen Veganismus und Genderismus, wiederzufinden. Daher braucht es diejenigen dringender denn je, die sich nicht den Sand des grünen Wirtschaftswunders in die Augen streuen lassen, sondern gerade an jene Individuen in unserer Bevölkerung appellieren, die noch nicht in der blökenden und Zustimmung klatschenden Schafherde untergegangen sind - und sich von unserem Oberhirten in der Berliner Waschmaschine etwas von einer positiven Zeitenwende eintrichtern lassen. Die sich an all die Distanzierten und Skeptischen wenden, welche sich nicht von Menschenfängern für den Fanclub "Uns Olaf" abwerben ließen. Und an Journalisten, welchen das Rückgrat und der Berufsethos noch mehr bedeuten als die Karriere oder das Wohlwollen ihrer Chefs, die ohne Rundfunkgebühren oder Presseförderung auf manchen Ledersessel in der Redaktion verzichten müssten.
Eine weitere Kartellbildung wird zwangsläufig zu einem zusätzlichen Erstarken der beiden Pole führen. Dies kann entweder mit den bereits bestehenden politischen Kräften geschehen - oder mithilfe einer weiteren Zersplitterung auf dem Tableau des politischen Wettbewerbs. Gleichsam sollte man sich nicht schon wieder Parallelen zur Weimarer Republik einreden lassen, denn es war nicht allein die Ausdifferenzierung der Parteienlandschaft, welche später in die Katastrophe führte. Dennoch können und sollten wir in einem Zeitalter der Egozentrik trotzdem versuchen, Interessen zu bündeln - statt uns aus Befindlichkeiten weiter aufzudröseln. Das Gebot der Stunde ist die Zusammenarbeit. Gerade auch dann, wenn sich der Block der Etablierten einer Kooperation mit dem wertkonservativ-nationalpatriotischen Lager schon aus antidemokratischem Prinzip heraus verwehrt. Ein Sammelbecken und eine Graswurzelbewegung derjenigen, die nicht weiter nach rechts gerückt sind, sondern die aufgrund des Linksdralls und eines durch die Einflussnahme einer oligarchischen Minderheit verschobenen Kompasses plötzlich als radikal, populistisch oder extrem gelten - obwohl sie heute keine anderen Positionen vertreten als noch vor ein paar Jahren. Sie sind lediglich standhaft geblieben, als man versuchte, die Landkarte neu auszurichten. Und gerade diese Leute braucht es, die auf dem "rechten" Weg sind - und sich ihre Standhaftigkeit auch nicht durch Moralisierung, Einschüchterung oder Drangsalierung nehmen lassen. Bündnisse all jener Zeitgenossen, die das Beste für unser Land möchten, die Brücken bauen können und sich dem Gespräch nicht verwehren. Die nicht nur für den eigenen Geldbeutel arbeiten, das Ich oder die Ideologie - sondern für ein Ende des Niedergangs, des Ruinierens, des Zerstörens von Heimat und Zukunft.
Der Sozialstaat kann nicht so bleiben, wie er ist!
Dass wir uns den immer weiter aufgeblähten Sozialstaat in Deutschland nicht mehr leisten können, das ist ein Befund, der nicht wirklich neu ist. Doch noch immer sind wir an einzelnen Stellschrauben beschäftigt, um die Zukunft unserer Sicherungssysteme zu gewährleisten. Zweifelsohne wird in diesen Tagen mit manch einer offensichtlich nicht umsetzbaren Forderung Populismus betrieben - während sie in der Diskussion nicht wirklich weiterbringt, sondern als erstes Wahlkampfgetöse beurteilt werden kann. Es ist beispielsweise nicht das Konzept und System vom Bürgergeld, das in seiner Gänze gescheitert wäre. Aber es bietet an zu vielen Stellen die Möglichkeit für Missbrauch, wenn beispielsweise Regelleistungen in großen Familien nahezu unbegrenzt kumuliert werden können - und Sonderbedarfe weitgehend ungeprüft gewährt werden. Es ist dazu der völlig überzogene Berechtigtenkreis, der unter anderem durch die Einbeziehung der "Kriegsflüchtlinge" aus der Ukraine noch einmal in einer irrsinnigen Weise strapaziert wurde. Nicht nur, dass damit der Grundsatz der Gleichberechtigung unter denjenigen negiert wurde, die einen Anspruch auf Schutz und Asyl begehren.
Es ist schlichtweg unverständlich, warum eine Personengruppe in den Genuss einer Transferleistung kommen soll, die zumeist noch keinen einzigen Cent an Steuern oder Abgaben in diesem Land bezahlt hat. Und natürlich ist es unbedingt nötig, den vom Bundesverfassungsgericht als grundgesetzkonform erklärten Gestaltungsspielraum zu nutzen, wonach denjenigen die Grundsicherung komplett sanktioniert werden kann, die eine zumutbare, den Qualifikationen und persönlichen Umständen angemessene, zumutbare und konkret auf dem Tisch liegende Jobgelegenheit zur Sicherung des Lebensunterhaltes ausschlagen. Denn es ist schon vom Gesetz her geregelt, dass es sich nicht um ein bedingungsloses Einkommen handelt - sondern um eine im Falle von Bedürftigkeit (die noch immer viel zu selten hinterfragt wird) und Erwerbslosigkeit die ständige Bereitschaft zur Aufnahme von Arbeit voraussetzende Unterstützung zur Überbrückung eines Lebensabschnitts, aber eben nicht eines Dauerzustandes.
Und auch mit Blick auf die Rente brauchen wir einen ganzen Blumenstrauß an unterschiedlichen Maßnahmen, um den massiven Auswirkungen des demografischen Wandels gerecht zu werden. Die Anlage von Kapital an den Aktienmärkten ist ein erster Schritt zur Stabilisierung der Finanzierungsgrundlage, der zumindest dann auch ohne ein allzu großes Risiko gelingen kann, wenn sich Experten darum kümmern, die nicht aus der FDP kommen - und Schwierigkeiten damit haben, einen vernünftigen und verfassungskonformen Nachtragshaushalt auf die Beine zu stellen, der nicht von Robert Habeck diktiert wird. Gleichermaßen müssen wir aus meiner Sicht wegkommen vom pauschalisierten Denken. Ein fixes Eintrittsalter in den Ruhestand wird den Anforderungen von Menschen mit unterschiedlichen Berufen nicht mehr gerecht. Stattdessen müssen wir zu einer Flexibilisierung und Individualisierung gelangen, welche Rücksicht darauf nimmt, wie sehr ein entsprechender Arbeitsplatz körperlich und psychisch anstrengt und verbraucht. Es gibt genügend Bereitwillige, die gerne und ohne Probleme über das 67. Lebensjahr aktiv sein können und wollen.
Doch es sind gerade die ehrwürdigen Aufgaben von Menschen, beispielsweise in der Pflege, in den Entsorgungsbetrieben, auf den Baustellen oder im Rettungsdienst, die durch ihr Engagement den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern und zu einem Funktionieren unseres Systems beitragen, denen wir es schuldig sind, sie im Zweifel auch früher in die Pension zu entlassen. Überholt scheint aus meiner Sicht auch die Zwei-Klassen-Mentalität. Wir müssen im 21. Jahrhundert zu der Auffassung gelangen, dass kollektive Teilhabe auch gemeinschaftliche Teilgabe bedeutet. Daher wäre es nur allzu vernünftig und gerecht, wenn alle Bürger in eine gesetzliche Versicherung einbezahlen würden - und somit an der Wohlstandssicherung eines jeden Mitglieds unserer Sozietät im Alter mitwirken. Bei einer immer weiteren Steigerung des Volkseinkommens und einer rückläufigen Bevölkerungszahl und sinkenden Lohnquote ist es ökonomisch geboten, den Faktor der Arbeit angemessen an den Produktivitätszuwächsen zu beteiligen.
Und wenn wir auf die Gesundheit blicken, so wäre es eigentlich eine logische Erwartung an die politisch Verantwortlichen, dass sie die psychische und körperliche Integrität der Bürger schützen und fördern - statt ihnen den Erwerb von Cannabis zu legalisieren, um sich das Versagen der Eliten schönzukiffen. Dass wir auch in diesem Bereich immer weiter ausufernde Kosten haben, liegt an einer Ineffizienz unseres Systems, in welchem eher Diagnosen und Krankheit belohnt statt Vitalität, Therapie und Prävention gefördert werden. Gleichsam brauchen wir mehr Sortierung, Ordnung und Lenkung. Die Patientensteuerung muss deutlich verbessert werden. So ist eine verpflichtende hausarztzentrierte Versorgung anzustreben, aber auch Disease-Management-Programme sollten zur Normalität werden. Eine zentrale Dokumentation von Untersuchungen, Befunden, Behandlungen und Medikation - wie sie beispielsweise in der elektronischen Patientenakte angestrebt wird -, kann unnötige Doppelgleisigkeit vermeiden. Natürlich braucht es hierbei eine maximale Datensicherung - und die Gewähr dafür, dass solche sensiblen Informationen lediglich den zuständigen Ärzten und Therapeuten zugänglich sind. Dass wir nicht mehr jedes Klinikum halten können, das scheint nicht nur aufgrund des Wirtschaftlichkeitsgebots selbstverständlich. Sondern es macht durchaus auch Sinn, besondere die Betreuung von komplexen und schwerwiegenden Krankheitsbildern zu zentralisieren - und sie dort anzusiedeln, wo eine größtmögliche Erfahrung, eine Breite an Ausstattung und eine multimodale Herangehensweise gegeben ist.
Gleichsam muss die grundständige Allgemein- und Notfallversorgung für jeden erreichbar bleiben. Dies kann beispielhaft durch Gesundheitszentren, Telemedizin und die Einbeziehung von weiteren Akteuren aus der dritten und vierten Säule, von Gemeindeschwestern bis zu mobilen Rettungsteams, von Pflegehelfern bis Vorsorgeberatern, durchaus nachhaltig und ohne größere Verluste in der Substanz der diakonischen Begleitung geschehen. Gleichsam braucht es weiterhin eine forcierte Anwendung des Grundsatzes "ambulant vor stationär". Wir sollten gerade in denjenigen Bereichen, in denen menschliche, empathische und fürsorgende Qualitäten weniger gefragt sind, auf künstliche Intelligenz, Technologisierung und Digitalisierung zurückgreifen. Ob dies nun in der Bürokratie, in der Aufzeichnung oder bei eintönigen Routineaufgaben ist. Darüber hinaus scheint es angezeigt, dass wir die Preise für Arzneimittel zu senken versuchen, indem wir wieder stärker in den internationalen Wettbewerb eintreten, die Produktion nach Deutschland und Europa zurückholen und mit den Unternehmen marktwirtschaftlich Rabatte aushandeln. Und auch in der Krankenversicherung gilt wie bei der Rente, dass wir das überholte Verständnis zwischen gesetzlich und privat Versicherten in Frage stellen sollten.
Über allem steht aber auch die für viele provokative, gleichsam aber ernüchternde Einsicht, dass wir unsere Strukturen nur dann werden halten können, wenn wir den Zugang zu unseren Systemen endlich für diejenigen verwehren, die aus aller Herren Länder zu uns strömen, allein aus wirtschaftlichen Aspekten und Lebensschicksalen, aber ohne eine tatsächliche Verfolgung. Die erhebliche Mehrbelastung aller sozialen Bereiche kann von der Gemeinschaft nicht länger aufgefangen werden. Wir sind nicht der Retter der Welt. Und wir haben auch keine moralische Verpflichtung, hiesige Standards für den halben Globus verbindlich zu machen. Das Märchen darüber, dass unsere Altersvorsorge nur durch Migration gesichert werden kann, ist ungefähr genauso glaubhaft wie die Feststellung, dass eine wachsende Kriminalität durch ausländische Gäste lediglich eine Aneinanderreihung von Einzelfällen sei. Hier müssen wir uns ehrlich machen und unsere geschichtsbedingten Minderwertigkeitskomplexe ablegen.
Wir schulden niemandem etwas, sondern wir sind unseren Boomern gegenüber verpflichtet, sie nicht länger Flaschen sammeln zu lassen - oder ihre Wohnungen für "Geflüchtete" freizugeben. Stabilität und Kontinuität kann nur gewährleistet werden, wenn wir nur die zu uns vor lassen, die an der Mitwirkung von Wohlstand, Wachstum und Prosperität bereit sind - und nicht in der Absicht zu uns gelangen, Direktleitungen in ihre Heimat zu legen und das hier erworbene Bargeld geradewegs an die Familie zu Hause weiterzureichen. Wir kommen auch in der sozialen Frage nicht umhin, bestimmte Ansprüche an die Nationalität und Staatsangehörigkeit zu knüpfen. Das hat nichts mit einer rassistischen Benachteiligung zu tun, sondern mit einem bereits in der Bibel verankerten Vorrangigkeitsgebot gegenüber unserem Nächsten aus der unmittelbaren Umgebung, der dem Fremden aus der Ferne in Sachen Unterstützung stets vorzuziehen ist.
Das Wertefundament in diesem Land gerät in Schieflage!
Wer in diesen Tagen rechts der SPD ist, gilt meist bereits als extrem. Und so hat es sich eine korrekte und wachsame Bewegung der Guten zur Aufgabe gemacht, all diejenigen entsprechend zu brandmarken und etikettieren, die sich einer bürgerlichen, identitären oder patriotischen Haltung verschrieben haben. Konservativismus in der Moderne bedeutet keinesfalls, rückwärtsgewandt zu sein. Geht man dem Wortursprung nach, so kommt man auf die Übersetzung des Bewahrens. Hinter dieser Vokabel befinden sich also diejenigen Menschen, die im Gegensatz zu einer nie im Einklang mit der eigenen Person stehenden Gesellschaftskohorte nicht nach ständiger Veränderung und unentwegtem Wandel streben. Sie tragen keine Verabscheuung des Vergangenen in sich, blicken in der Geschichte nicht allein auf die Verbrechen, die von Deutschland begangen wurden. Sie vergessen nicht die Aufarbeitung, die Reue und Sühne unseres Landes, aber auch nicht die Verantwortung, die wir zweifelsohne mit Blick auf den Nationalsozialismus als Mahnung in uns tragen. Sie wollen nicht krampfhaft weg von der Historie - und sich deshalb auch nicht all dessen entledigen, was durch die grausamen Verbrechen in den Diktaturen unbeschmutzt blieb. Ihre Verachtung richtet sich damit auch nicht gegen alles Funktionierende, gegen alles Erfahrene, gegen alles Gelungene. Im Gegenteil. Sie sind auf Beständigkeit angelegt - und möchten nicht auf Teufel komm raus einen Umbruch, einen Schnitt oder eine Brandmauer zum Gestern.
Dass es in unserer Bevölkerung einen nicht geringen Teil von Älteren und Jüngeren gibt, die auch weiterhin dem Credo "Früher war nicht alles schlecht" anhängen, das zeigt der Zuwachs in den Jugendorganisationen der eher rechts gelagerten Parteien. Und auch wenn man die Umfragen unter den bis zu 25-Jährigen verfolgt, so ergibt sich nicht das Bild, das sich vielleicht die Grünen erhoffen würden. Denn es ist mittlerweile nicht mehr woke, sondern en vogue, mit ziemlich viel Stolz auf das zu blicken, was die sogenannten Boomer nach dem Zweiten Weltkrieg aus einer völlig zerstörten Republik wieder aufgebaut haben. Es sind auch ihre Tugenden wie Fleiß, Anstrengung, Bemühen, Erfolg, Selbstwirksamkeit, Gemeinschaft oder Leistung von damals, die heute wieder attraktiv für die sind, denen unser Land nicht egal ist. Denn es ist eben nicht so, dass die Anhänger der sogenannten "Generation Z" das Bild über unseren Nachwuchs prägen. Sie mögen vielleicht von linken Leitmedien Aufmerksamkeit bekommen, um ihr Ideal der Work-Life-Balance und einer 20-Stunden-Woche postulieren zu können. Aber deren Bequemlichkeit ist nicht repräsentativ, sie findet mittlerweile weder bei früheren Jahrgängen noch den Gleichaltrigen allzu viel Anklang. Denn es ist durchaus ein Ausdruck von Schwäche, von mangelnder Motivation, fehlender Lebensfreude und großer Desorientierung, wenn man sich dauerhaft auf dem Ozean der Sinnsuche bewegt - ohne aber wirklich an einem Ziel ankommen zu wollen.
Fest vor Anker gehen und damit Heimat in allen Belangen zu finden, das ist mittlerweile ein Bestreben von vielen Heranwachsenden, die sich unter anderem auf das Verlassen wollen, was schon seit jeher erfolgreich praktiziert wurde - und zum Erfolg führte. Wir räumen heutzutage viel zu schnell unsere Häuser und Wohnungen aus, trennen uns reflexartig vom Verstaubten, ohne darin die Schätze zu erkennen, die viel Leid, Tiefen und Herausforderungen überstanden haben. Resilienz zeigen und sich nicht von der Zeitgeistigkeit vereinnahmen lassen - diesen Auftrag beherzigen wir, wenn wir das Vorzeitige hegen und pflegen - und das Neue und Künftige mit Maß und Verstand weiterentwickeln. Das beharrlich dissoziierende Verhalten einer Spezies, die das Imperfekt partout von sich abstreifen will - und allein auf das Futur bauen möchte, wird rasch bemerken, dass eine Burg nur dann als Fels in der Brandung widerstehen kann, wenn sie auf einem festen Fundament errichtet wurde. Und so sind es unsere Normen, unsere Traditionen und unser Brauchtum, die uns Kongruenz und Echtheit verleihen. Wenn wir gemeinsam wissen, worauf wir uns verständigt haben und worauf wir uns verbindlich beziehen können, strahlen wir Authentizität, Halt und Stärke gegenüber uns selbst und all denjenigen aus, die zu uns hinzustoßen. Es ist damit unter anderem die sogenannte Leitkultur als ein absolutes Minimum an Gewähr, die neben vielen anderen Faktoren wie der Sprache, der Religion, der Werte, der Sozialisation, der Wurzeln oder der ethnischen Verbundenheit zu einem plausiblen Gesamtbild beitragen.
Dass wir uns mit der teils wahnhaft anmutenden Fiktion des Globalismus, des Genderismus, des Queerismus, der Transformation oder der Zeitenwende unter Druck setzen, uns von der Ölheizung bis zum Verbrenner, vom Atomkraftwerk bis zum Schnitzel, vom Geschlecht bis zum generischen Maskulinum, vom Frieden bis zum Kruzifix, zwanghaft zu verabschieden und uns dessen entledigen, was nicht mehr in die Welt von Ökosozialismus, Veganismus, Kriegstüchtigkeit und Pluralismus passt, gleicht einer Entkernung unserer Seele, unserer Persönlichkeit und unserer Souveränität. Denn obwohl Dinge praktikabel, erfahren und zuverlässig sind, müssen sie aus Sicht derjenigen weg, die sich in ihrer eigenen Haut, in ihrem Land und in unserem Miteinander nicht einleben können - oder sich als prinzipiell antisoziale Wesen gebärden. Ein Kontinuum ist nur dann stabil, wenn es nicht nur einen Pflock in der Zukunft, sondern eben auch in unserem Vorleben hat. Denn es sind die Überlieferungen des Erprobten, die Grundlage für die Schaffung von Frischem und Fortschrittlichem überhaupt erst bereitstellen. Wer die Bedeutung von Routiniertem, Geübten und Sattelfestem verkennt, weil er sich aus einer Ideologie heraus verpflichtet fühlt, die Lebensgrundlagen dieser Welt im Boden zu lassen und stattdessen die Landschaft mit Windrädern und Solarpanelen zuzupflastern, mit Sternchen, Doppelpunkten und Binnen-I das Deutsche zu verhunzen und der Beliebigkeit des Feminismus zu frönen, sich lieber als Gurke wahrzunehmen denn als Mann oder Frau, die seltene Ressourcen verbrauchende Wärmepumpe einer sich auf gutem Weg des Recyclings von Brennstäben befindlichen Kernenergie vorzuziehen, das Abendland gegen Buntland auszutauschen oder Kinder und Familie als Karrierekiller denn als Geschenk wahrzunehmen, der mag sich als Retter der Welt sehen - und bleibt in Wahrheit ein bemitleidenswerter Irrlichtender ohne Kompass, aber mit einer großen Menge an Pseudo-Heroismus.
Glaube
Seelsorge/Laienprediger: Seelsorge@Riehle-Dennis.de
Philosophischer Laienarbeitskreis: PLAK@Riehle-Dennis.de
Sie können sich auch über das Kontaktformular melden.
Ich unterstütze das Projekt:
Gedanken zum Christsein
Mein Glaube in der Zusammenfassung:
Ich glaube an einen persönlichen Schöpfer - und auch an Christus als eine prägende Gestalt in der Geschichte, die allerdings nicht ohne Sünde war und für mein Verständnis auch keiner Heroisierung bedarf. Bliebe es anders, wäre er zwar vielleicht der eingeborene Sohn - aber eben kein Ebenbild des Menschen. Denn wir alle sind fehlbar - und nicht wenige biblische Stellen überliefern uns eine durchaus aufbrausende bis jähzornige Persönlichkeit von Jesus.
Für mich ist die Heilige Schrift eine überaus wertzuschätzende, aber eben nicht absolute Sammlung von metaphorischen Lebensweisheiten, denen ich in meinem persönlichen Dasein nach einer kritischen Exegese nachfolge. Ich begreife die Auferstehung nicht als leibhaftig, sondern als einen Ausdruck dessen, dass wir in den Herzen unserer Liebsten, in den Erinnerungen der Gemeinschaft und mit den hinterlassenen Spuren im Sand der Welt ewig leben.
Ich bin überzeugt, dass sich Gott vor allem als Ursprungskraft und durch die Gesten, Solidarität und Hilfsbereitschaft unserer Nächsten offenbart. Sie dienen ihm als ein Werkzeug, um uns beim Durchstehen von Qual und Pein zu helfen. Denn mit der Osterparabel verbindet sich zwingend die Passion als das Tragen des Kreuzes, als die Last auf unseren Schultern. Der Herr befreit uns nicht von dem Leiden, weil er uns Eigenverantwortlichkeit und Freiheit geschenkt hat. Wir sollen die Tiefen und Täler durchschreiten, damit wir eine Katharsis erleben und neues Wachstum zu erfahren.
Er lässt uns nicht am Boden liegen, sondern reicht uns durch unsere Wegbegleiter seine Hand. Er erfüllt uns durch die Schönheit der Natur mit seinem Geist, zeigt sich in den kleinen Dingen des Alltags, die wir allzu oft übersehen. Wir müssen keine Leistung erbringen, um durch ihn Liebe und Annahme zu erfahren. Stattdessen reicht ein Vertrauen in die Fügung der Welt und auf seine Gnade und Barmherzigkeit.
Für Freidenker und Atheisten werde ich in dieser Naivität zum Spott, für die evangelikalen und orthodoxen Christen wiederum ein Dorn im Auge, weil ich mich von Dogmatik und klerikaler Obrigkeit losgelöst und mich einer eigenen spirituellen Erfüllung hingegeben habe. Sie mag nicht strenggläubig sein. Aber sie hat auch nichts mit einer Patchwork-Religiosität zu tun. Denn ich vertrete meine Überzeugungen mit Haltung und Rückgrat, mit größtmöglicher Geradlinigkeit und Kontinuität. Dass sie inhaltlich nicht dementsprechend mögen, was sich der rechtschaffende Diener unter der Arbeit im Weinberg vorstellt, damit kann ich gut leben. Und auch mit der Tatsache, dass ich für Manche zum weltanschaulichen Reibungspunkt geworden bin.
Und jetzt ausführlicher:
Liebe Besucher!
Wie soll ich mir die Auferstehung Jesu tatsächlich vorstellen? Warum soll gerade er denn nun dieser Sohn Gottes sein? Und wie ist er in den Himmel aufgefahren? Lange Zeit sprach ich das Glaubensbekenntnis mit, ohne mir wirkliche Gedanken darüber zu machen, was ich dort eigentlich wiedergebe. Und überhaupt: Warum greift Gott nicht in das Geschehen der Welt ein, wenn man ihn am meisten brauchen würde? Die klassische Theodizée-Frage erreichte mich nicht umsonst, als ich selbst merkte, dass die Kirche keinesfalls der Ort von Heiligkeit ist, für den ich ihn lange gehalten hatte. Ausgrenzung aufgrund sexueller Orientierung, wegen seelischer Probleme, ein wahrlicher Spießrutenlauf durch die zahlreichen Anfeindungen von Geistlichen und auch Laien waren irgendwann zur Tagesordnung geworden. Und ich zweifelte tatsächlich: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“. Gesundheitliche Leiden plagten mich, der soziale Halt, den die Gemeinde geboten hatte, war verschwunden – und ich spürte, dass auf keines meiner Gebete noch eine Antwort kam.
Dabei hatte ich über viele Jahre eine Menge guter Erfahrungen gesammelt. Mit großer Freude die Ausbildung zum Prädikanten und in der Seelsorge absolviert, in der Gemeinde viel Sinnstiftendes erlebt, Gottesdienste gestaltet, Konfirmanden unterrichtet, Andachten gehalten. Doch plötzlich war ich für die Jugendarbeit nicht mehr der Richtige, war die Citypastoral kritisch geworden, weil ich die katholischen Vorgaben nicht hinnehmen wollte – und diejenigen Mitchristen, denen ich noch vor ein paar Wochen freundschaftlich begegnet bin, wechselten unverhohlen die Straßenseite, ohne mich eines Blickes zu würdigen. Wie sollte also ein theistischer Gott aussehen, der hierbei tatenlos bleibt, zusieht, ohne ein Zeichen zu senden? Jahre ließ ich vergehen, die Skepsis wurde immer größer. Schlussendlich die Frage: Kann ich weiterhin einem „Verein“ angehören, der mich offenbar nicht will und dessen Grundlagen ich mittlerweile kaum noch überzeugt mitgetragen habe, lediglich aus dem Umstand, weil „man“ es eben so macht? Die Antwort kam eines Nachts: Am nächsten Morgen unterschrieb ich meine Austrittserklärung aus der Kirche – und erlebte einen befreienden Moment.
Recht engagiert orientierte ich mich neu: Humanismus sollte es sein. Über ihn hatte ich mich bereits im Vorfeld informiert und war begeistert von den Überlegungen, die er teilte. Der Einstieg in die säkulare Szene fiel somit leicht, öffnete ich mich doch den Weltanschauungen zwischen Atheismus und Freidenkertum, um zu erfahren, wo künftig meine eigene Heimat sein sollte. Zweifelsohne ist es in einer sich anscheinend kirchenferner entwickelnden Gesellschaft aber dennoch schwierig, mit anderen Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen. Nach Gründung der „Humanistischen Alternative Bodensee“ mit einigen Mitstreitern wurde deutlich, dass sich all diejenigen, die keiner Kirche angehörten, nicht zwingend daran interessiert sind, sich für eine humanistische Orientierung auch wirklich einzusetzen. Die Erfahrungen aus der „Institution Kirche“ schreckten viele ab, sich neuerlich an eine Organisation zu binden – egal, wie offen man sie auch gestaltet. Und nicht wenige Menschen sind zwar konfessionsfrei, aber nicht gleichsam ungläubig, sondern viel eher agnostisch denkend.
Doch das waren nicht die einzigen Probleme: Der „Evolutionäre Humanismus“ gibt sich nicht nur kirchenkritisch, er zeigt sich in Teilen sogar extrem. Mit einer rigorosen Ablehnung von Religion wird der Andersdenkende nicht selten diffamiert. Jene, die – wie ich – den Respekt vor jeder Form des Glaubens als notwendig ansehen, werden nicht selten als Unterstützer der Kirchen beschimpft, als immer noch nicht vom Christentum Losgelöste. Ein Schwarz-Weiß der besonders deutlichen Linie, das in Teilen weit über die Attacken hinausgeht, die mir aus kirchlichen Reihen geläufig waren. Der Humanismus wurde bis auf die Spitzen des Denkbaren getrieben – die Selbstverherrlichung des Menschen findet nicht nur in den Aussagen zur Existenz eines Gottes ihren Ausdruck, nach denen sich der Einzelne selbst zum Mittelpunkt des Universums zu erklären vermag. Darüber hinaus spricht er sich durch das Gedankenexperiment eines grenzenlosen Transhumanismus die eigene Fähigkeit zur Reflektion und des Schutzes vor seinen persönlichen Allmachtsphantasien ab. Nicht zuletzt überhöht er sich einer Ethik, die das Angewiesensein auf eine Solidarität untereinander formuliert, indem er den Individualismus einem Anspruch auf Leben aller Menschen vorzuziehen scheint.
Schließlich fiel auch auf, dass die Antworten von atheistischer Seite auf wesentliche kritische Betrachtungen einer Ideologie der Gottlosigkeit spärlich waren. Oftmals wird auf die Evolution verwiesen, die zum Zustand der heutigen Galaxien geführt haben soll. Der Urknall als deren Anfang bleibt in seiner Entstehung trotz zahlreicher Erklärungsversuche aber bislang noch immer nebulös. Der Wahrheitsanspruch des Atheisten dagegen wächst weiter – und das oftmals ohne nachhaltige Belege, die wiederum von den Religionen eingefordert werden, dort aber gleichsam obsolet sind, liegt zwischen Glaube und wissenschaftlichem Anspruch auf Realität doch bekanntlich der Gedankenfehler, Äpfel mit Birnen vergleichen zu wollen. Und ebenso die „Natur“. Sie soll den Zusammenhalt der Welt begründen. Doch niemand aus dem säkularen Kreise fragt ernsthaft nach deren Ursprung.
Die verherrlichten „Natur-Gesetze“, sie lassen uns zwar nachvollziehen, aber nicht verstehen, wo die Basis all des Wundersamen liegt, das mancher Atheist so krampfhaft als Träumerei und „Heiligen Geist“ zwischen unserem Himmel und der Erde verspotten will. Substantielle Antworten waren begrenzt, wenn ich auf die Zeit von insgesamt vier Jahren blicke, in denen ich bisher die säkulare Bewegung beobachtet habe. Da machen sich „Spaghettimonster“ viel eher lustig darüber, dass Kirchen an ihren Traditionen festhalten, während sie selbst mit Nudelsieben auf dem Kopf den Anspruch auf gesellschaftliche Anerkennung erhoffen. Ja, Religionsfreiheit muss auch das aushalten. Doch gleichsam ist der Rundumschlag gegen alles, was mit Religion zu tun hat, ebenso ein erfolgloser Versuch, der Menschheit ihren Glauben austreiben zu wollen. Da tummeln sich im Spektrum des Säkularen nicht wenige Linksradikale, die ihr Freidenkersein mit der politischen Ambition einer unkritischen Russlandfreundlichkeit und sozialistisch bis kommunistisch angehauchten Systemkritik verbinden, ebenso wie rechtslastig anmutende Islamfeinde, die ihren Atheismus als Beweggrund für alles Religiöse auch dafür hernehmen, rassistisch orientierte Hetze gegen Muslime zu begründen. Nicht, dass es solche Phänomene nicht auch unter gläubigen Menschen gäbe. Doch keinesfalls ist der humanistische Atheismus so friedlich, wie er es oft vermitteln möchte. Die fehlende Wertschätzung des Glaubens im Allgemeinen macht den Säkularismus nicht selten zu einer emotionslosen Philosophie, die man als Distanzierter durchaus auch als Kälte deuten könnte.
Daneben sind auch die notwendigen Positivaussagen des Humanismus wenig stichhaltig geblieben. Eine Überzeugung von der eigenen Persönlichkeit, ein Glaube an die Vernunft und an den Realismus aller Dinge – das sind keine wirklichen Antworten auf die Sinnfragen, die die Menschen umtreiben. Die säkulare Bewegung hat es verpasst, ein Konzept zu entwickeln, mit dem sie auch die Gefühle anspricht, die nicht nur nach Karl Marx nötig sind, wenn er die Religion nicht vollkommen zu Unrecht als Opium ansieht, das uns geistigen und gleichermaßen eben auch geistlichen Halt gibt in einem Hiersein, zudem nicht nur die Höhen, sondern eben gleichermaßen die Tiefen gehören, in denen es Hoffnung braucht. Da hilft uns nicht das Erklärbare, sondern die stützende Kraft des Visionären, egal, wie stark mein Glaube an einen Gott ist. Der alleinige Blick auf das zu Greifende ist dann nicht ausreichend, wenn „soft skills“ gefragt sind. Nutzt es einem Jeden von uns wirklich, mit stoischer Klarheit auf das rein Materielle durch die Welt gekommen zu sein, wenn wir aus purem Idealismus letztlich doch seelisch verhungern? Da geht es um mehr als Mitmenschlichkeit, da geht es vor allem auch um persönliche Weitsicht mit dem eigenen Ich und in der nachhaltigen Gestaltung des Zusammenlebens unter dem Eindruck einer Demut, die dem Umstand unserer Rolle in dieser Schöpfung vollkommen gerechtfertigt ist.
Nein, einen humanistischen und säkularen Blick auf die Gesellschaft, auf mein Leben und auf die Zusammenhänge des Universums habe ich nicht verloren. Doch er kann nur Teil einer religiösen Überzeugung sein, die einerseits auf einer Basis gemeinsamer Wertvorstellungen, Vorbilder, Werte, Bräuche, Ideale und andererseits eines Glaubens zu fußen versucht, der sich nicht mit Belegen einer augenscheinlichen Wirklichkeit zufriedengibt, sondern zu Ehrfurcht vor etwas deutlich Größerem und potenziell kausal Begründbarem bereit wäre. Dazu gehört auch, Bescheidenheit zu üben. Hingabe vor dem, was nicht nur meine eigenen Horizonte übersteigt, sondern auch weit über meine persönliche Selbstbestimmung hinausgeht und seine Grenzen dort findet, wo die Würde auch meiner Nächsten noch unberührt bleibt. Da bricht sich der Mensch keinerlei Zacken aus seiner aufgesetzten Krone des egoistisch anmaßenden Selbstverliebtseins. Solch eine Einstellung ist für meine Verständnisse nur dort denkbar, wo auch Religion kritisch, aber nicht pauschal rückweisend betrachtet wird. Heute bin ich nach meinem Ausflug in den reinen Säkularismus wieder zurückgekehrt: Meinen Glauben hatte ich nie verloren, ich zweifle auch noch heute an Vielem, was das Christentum lehrt und die Kirche vorgibt. Doch ich bin wieder in meiner Heimat, die getragen ist vom notwendigen Fragen und auch Klagen, vom Grundvertrauen an einen Gott, von einem Ja zu Jesus Christus, von dem zwingenden Miteinander aus Staat und Kirche, das so viel Trennung braucht, wie erforderlich, gleichzeitig aber so viel an Zusammenarbeit wie nötig, von einem Humanismus, der die Selbstverantwortlichkeit des Menschen auf unserer Erde herausarbeitet und ihn in den Raum seiner vertretbaren und Gemeinwohl orientierten Möglichkeiten stellt, und von einem Glauben, der letztlich so frei ist, dass er Toleranz erfährt, wenn er auch nicht immer geteilt wird.
Leider hat die Kirche meinen freien Glauben nicht respektieren wollen, stattdessen trage ich damit "Eulen nach Athen" - wie man es formulierte. Und nachdem man sich offenbar auch in protestantischen Kreisen mit diversitätssensibler Sexualität weiterhin schwertut, habe ich mich entschieden, mein Christsein außerhalb der Konfession zu leben...
Möchten Sie mir von Ihren Glaubenserfahrungen berichten oder mit mir über meine Geschichte ins Gespräch kommen? Dann schreiben Sie mir gern - ich freue mich über Ihre Nachricht an Riehle@Riehle-Dennis.de.
Herzliche Grüße
Ihr Dennis Riehle
Lebensschutz
Ich gebe zu: Als links denkender Mensch habe ich es schwer, mit wertkonservativen Ansichten zu punkten. Denn zumeist wird in der angeblich doch so liberalen Gesellschaft von heute ein Mainstream vertreten, der es ausschließt, mit „bewahrenden“ Standpunkten Politik zu machen. Dabei halte ich es für zweifelsohne richtig und gleichsam völlig notwendig, dass wir an Werten, Traditionen und gemeinschaftlichen Normen festhalten, die sich als plausibel herausgestellt haben. Und so war es lange Zeit in unserem Land scheinbar unbestritten, dass Abtreibungen grade nicht zur Alltäglichkeit gehören.
Dieser Konsens wurde aber durch eine falsch verstandene Emanzipation aufgekündigt – und das Aufkommen massiver Proteste gegen den Lebensschutz macht deutlich, dass gerade Lobbygruppen für den Feminismus versuchen, Menschenrechte gegeneinander auszuspielen. Das wird besonders erkenntlich, wenn unterschiedliche Interessenvertreter dafür plädieren, den im Strafgesetzbuch weiterhin verbotenen Schwangerschaftsabbruch, der lediglich unter gewissen Voraussetzungen ungeahndet bleibt, komplett zu legalisieren. Mit dieser Forderung wird ein deutliches Zeichen gesetzt, denn nicht nur DIE LINKE oder „Terre des Femmes“, sondern beispielsweise auch „Amnesty International“ (AI), erheben das Selbstbestimmungsrecht der Frau in den Stand der Unantastbarkeit, während ich schon einzelne Mitglieder erlebt habe, die das Recht eines Ungeborenen auf irdische Existenz häufig damit abtun, dass es sich bei heranwachsendem Leben im Mutterleib ja lediglich um einen „Zellklumpen“ handelt, der noch keinen Anspruch auf irdische Existenz erheben könnte (wenngleich sich alle Organisationen zumindest öffentlich um eine konkrete Aussage zu drücken versuchen, wann das menschliche Dasein in ihren Augen nun tatsächlich beginnt). Insofern ist die Frage nach dem Entstehungsmoment des menschlichen Lebens eng mit der Entscheidung verbunden, wie wir die nur scheinbar gegenläufigen Standpunkte in Einklang bringen können.
Für mich ist klar: Ich werde auch weiterhin dafür eintreten, dass Abtreibungen nicht zu einer gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit werden. Ich lehne zwar jeglichen Angriff von radikalen Vertretern der Lebensschutzbewegung gegen schwangere Frauen auf das Schärfste ab. Gleichsam erhebe ich aber den Wunsch, dass auch meine Sichtweise mit Respekt behandelt wird. Denn ich will mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass wir Schwangerschaftsabbrüche zu einer uniformen Errungenschaft der Neuzeit machen, weil wir mit der Argumentation der universellen Verfügung der Frau über ihren Körper einen medizinischen Eingriff rechtfertigen, der auch in Zukunft nicht ungezwungen sein wird. Immerhin vergessen viele Verfechter einer vollständigen Freigabe der Abtreibung die massiven Konsequenzen des Schwangerschaftsabbruchs für die Frau: Depressionen, Schuldvorwürfe und Selbstzweifel gehören zu den Folgen, die von Frauenrechtlern gerne verschwiegen werden. Da nutzt es auch nichts, die Phrase der ungewollten Empfängnis zu schwingen. Denn in aller Regel werden Frauen heute nicht mehr unfreiwillig schwanger.
Und es gehört zu der propagierten Selbstbestimmung dazu, dass sich Menschen bereits vor dem Geschlechtsakt über die möglichen Auswirkungen von Zweisamkeit Gedanken machen sollten. Denn wir können von mündigen Frauen erwarten, für ihr Handeln Eigenverantwortung zu übernehmen. Und es ist eben kein „Spiel“, miteinander zu schlafen. Auch wenn wir in der Moderne den „Quickie“ oder den „One-Night-Stand“ als eine völlig gewöhnliche Form der Sexualität betrachten, bleibt die Verschmelzung von Mann und Frau ein Geschenk, das wird endlich wieder würdigen sollten. Denn für mich beginnt genau zu diesem Moment, in dem sich zwei Menschen für das Austragen von Liebe entscheiden, der Gedanke an ein neues Leben. Nein, wir müssen nicht auf einen Embryo im Mutterleib warten, ehe wir begreifen, dass Intimverkehr seit jeher in erster Linie der Zeugung von Nachwuchs dient – und nicht dem Abbau von „Druck“, dem puren Spaß oder der alleinigen Befriedigung von Trieben und Bedürfnissen. Zweifelsohne: Ich bin davon überzeugt, dass wir Leidenschaft und Erotik heute ad absurdum geführt haben, weil wir den Maßstab von Sinnlichkeit in Richtung Fleischeslust immer weiter verschieben. Genau deshalb legitimiert sich für viele Anhänger einer Abschaffung der „Abtreibungsparagrafen“ deren Perspektive, Schwangerschaft als „Ausrutscher“ degradieren zu dürfen, deren Resultat nach einhelliger Meinung ja schnell einmal und ganz nebenbei „weggemacht“ werden kann. Dass damit das ungeborene Leben mit Füßen getreten wird, scheint unter der Monstranz der Selbstbestimmtheit einer Frau letztlich nachrangig. Doch können wir von aufgeklärten Menschen nicht verlangen, dass sie mit der ihnen gegebenen Freiheit zur Selbstentscheidung verantwortlich und nachsichtig umgehen? Es ist für mich ethisch verwerflich, wenn man sich im Augenblick der Geschlechtlichkeit nicht für das potenzielle Ergebnis seiner Gelüste interessiert, weil die Medizin dieser Tage im Zweifel jeden „Fehltritt“ rückgängig machen kann.
Diese Leichtigkeit im Sein ist nach meinem Verständnis ein wesentliches Gesellschaftsproblem unserer Dekade. Wir bedenken unser Tun kaum mehr, sondern vertrauen darauf, dass alles möglich ist – auch wenn es vielleicht bei näherem Hinsehen nicht sinnvoll erscheint. Denn für mich kommt es einer Perversion gleich, wenn wir unsere Gleichgültigkeit über ein heranwachsendes Leben stellen. Sex und Abtreibung, sie gehören heute offenbar untrennbar zusammen. Und weshalb sollte man zu viele Überlegungen verschwenden, wenn man seine „nicht beabsichtigte“ Schwangerschaft doch mit einer kleinen Korrektur wieder „ausbügeln“ darf. Denn wir verhindern mit einer Schwangerschaft auch die Chance eines Ungeborenen, überhaupt diese Welt zu erblicken. Ist es nicht übergriffig, wenn sich Frauen anmaßen, aus einer ins Abstruse getriebenen Autonomie über das Hin und Her von Leben und Tod zu befinden? Ich erwarte von jedem Menschen, dass er seine irdische Existenz dafür nutzt, mit sich und anderen pflichtbewusst umzugehen, statt sich eine Moral der Beliebigkeit zu konstruieren, die auf Kosten von Nachwuchs geht, der nicht nur das größte Kompliment der Schöpfung an unsere Spezies ist, sondern auch unseren Fortbestand sichert. Es ist unbestritten, dass Abtreibung in Ausnahmesituationen auch weiterhin möglich bleiben muss, denke man nur an eine Vergewaltigung, für deren Opfer es nicht hinnehmbar wäre, ein Kind auszutragen, das wissentlich mit Gewalt und gegen den Willen der Frau entstanden ist. Oder aber die akute Gesundheitsgefahr für die werdende Mutter, die im Rahmen einer Schwangerschaft durchaus auftreten kann.
Allerdings plädiere ich dafür, dass wir nicht allein auf subjektive Merkmale setzen, die zu einem automatischen Recht auf unmittelbare Abtreibung führen: Immer wieder wird von Frauenschützern unterstrichen, dass es einer Familie nicht zuzumuten wäre, ein Baby großzuziehen, das mit einer voraussichtlichen Behinderung geboren würde. Denn auch hier will ich fragen: Wie sehr muss sich unser Verständnis von „Normalität“ verändert haben, wenn wir es offenbar nicht ertragen können, einen Sohn oder eine Tochter mit „Ecken und Kanten“ zu lieben, anzunehmen und vor der Oberflächlichkeit der Welt zu verteidigen? Ja, der Dammbruch hin zu einem designten Nachkommen ist von der Wissenschaft bereits verursacht worden. Mit der pränatalen Diagnostik betreiben wir eine Selektion, anstatt werdenden Eltern staatlich wie gesellschaftlich beizustehen, um gerade auch solch einem besonderen Kind das Dasein zu ermöglichen. Ohnehin: Statt Abtreibungen freizugeben, fehlt es an Unterstützung in jeglicher Hinsicht: Finanzielle Probleme, sozialer Status und familiäre wie berufliche Verhältnisse sind kein Grund für einen Schwangerschaftsabbruch.
Das Netz an öffentlicher Absicherung ist groß, muss aber ausgeweitet werden, damit unsicheren Müttern vor allem die Sorge vor existenzieller Not genommen werden kann. Insofern braucht es durchtragende Hilfen, die ein „Ja“ zum Leben für das Ungeborene bestärken und Familien jeglicher Herkunft und Schicht die Chance eröffnen, sich zu ihrem Kind zu bekennen. Gerade, um ihnen im Vorfeld des Entschlusses über einen Abort Klarheit und Transparenz zu all den Fördermaßnahmen zu geben, die sie in einer Fortführung der Schwangerschaft bestätigen könnten, ist auch weiterhin die verpflichtende Beratung notwendig – ehe eine Abtreibung nach geltenden Gesetzen sanktionslos bleiben kann. Und nein, damit wird keine einzige Frau „diskriminiert“, wie es uns mancher „Emanzipator“ einreden möchte. Im Gegenteil: Es ist ein Schlag ins Gesicht derjenigen Menschen, die tatsächlich Diskriminierung, Stigmatisierung und Ausgrenzung ausgesetzt sind. Schwangere sind weder krank, haben keine Behinderung und besitzen keine Merkmale, aufgrund derer sie gemieden würden. Deshalb ist es völlig abwegig, wenn sie nach Gleichberechtigung rufen und sich zurückgesetzt fühlen, wenn ihnen der ungehinderte Zugang zur Abtreibung verwehrt wird. Denn es kann kein Grundrecht auf einen barrierefreien Schwangerschaftsabbruch geben, denn dieses würde offenkundig mit dem Verfassungsgut der Menschenwürde Dritter, die nach unserem Grundgesetz eben auch dem ungeborenen Leben zusteht, kollidieren.
Ja, ich stehe mit meiner Position manches Mal auf schier verlorenem Posten. Aber das Ringen um jedes einzelne Leben, ob der Mutter oder des werdenden Kindes, ist es mir wert, nicht selten für meine Haltung angefeindet zu werden. Ich weiß auch, dass es andersherum zu ähnlichen Grenzüberschreitungen kommt – beispielsweise dann, wenn Ärzte bedroht werden, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Letztlich erleben wir seit geraumer Zeit eine massive Zuspitzung der Emotionalitäten in unserer Bevölkerung. Da werden die angegriffen, die sich gegen den Zeitgeist stellen, schlussendlich aber nur ihre legitime Meinung kundtun. Und da werden die verunglimpft, die im Rahmen unserer Rechtslage Abtreibungen vornehmen, weil manchen Menschen ihre Ideologie zu Kopf gestiegen ist. Wo ist die Kultur des gegenseitigen Respekts geblieben, die anderslautende Überzeugungen toleriert und im demokratischen Sinne einen bestmöglichen Austausch von Beweggründen erlaubt? Ich denke, es ist richtig, dass wir Medizinern auch weiterhin die Werbung für den Schwangerschaftsabbruch verbieten, denn es geht bei solch einem invasiven Vorgehen nicht um eine ärztliche Leistung im eigentlichen Sinn. Ich will niemandem unterstellen, seine medizinische Dienstleistung allein aus Profit heraus anzubieten. Dennoch ist es nachvollziehbar, dass es einem Arzt, der schlichtweg doch ein selbstständiger Unternehmer ist, nicht abverlangt werden kann, wertfrei und ohne Beeinflussung auf das Angebot der Abtreibung aufmerksam zu machen. Daher muss die Information über den Schwangerschaftsabbruch weiterhin in den Händen von Unabhängigen bleiben, die aus der Unterrichtung keinen Gewinn erzielen können.
Zusammenfassend sei gesagt: Wir sollten unseren technischen Fortschritt nutzen, um Abtreibungen in den allermeisten Fällen überflüssig zu machen. Die Empfängnisverhütung ist heutzutage jeder Frau zugänglich – und ich vertraue darauf, dass sie souverän genug ist, die Abwägung über eine Schwangerschaft zu einem Augenblick zu treffen, an dem das Kind wortwörtlich noch nicht „in den Brunnen gefallen ist“. Auf mich wirkt die derzeitige Buschtrommelei der Frauenrechtler peinlich und demaskierend zugleich: Offenkundig können sie sich nicht darauf einlassen, der ihr vertretenen Personengruppe ausreichend viel autarke Reife zuzubilligen. Denn schlussendlich ist der Kampf für eine Legitimation der Abtreibung zu jedwedem Zeitpunkt ein Eingeständnis, dass Frauen scheinbarer Bevormundung bedürfen. Ich glaube, das weibliche Geschlecht ist schon viel weiter, als es ihre selbsternannten Interessenschützer uns weismachen wollen. Nach meiner festen Überzeugung ist die „Frau von Welt“ im 21. Jahrhundert sehr wohl in der Lage, sich in den gesetzten Grenzen der Gesetzgebung zurechtzufinden. Letztlich helfen die klaren Vorgaben dabei, einerseits werdende Mütter vor unüberlegten Kurzschlusshandlungen zu bewahren, Schwangerschaftskonflikte aufzudecken und zu klären sowie psychische Nachspiele zu vermeiden. Und andererseits erhöhen die der Abtreibung vorgeschalteten Bedingungen die Perspektive darauf, dass viele ungeborene Menschen doch noch die Gelegenheit bekommen, aus dem Bauch der Mama zu schlüpfen. Insofern halte ich die derzeitige Regelung nicht nur für sittlich ausgereift, sondern vor allem derart ausgewogen, dass die Rechte von allen Beteiligten Berücksichtigung finden. Denn Schwangerschaft ist eben keine Privatsache!
Im Übrigen: Zum Lebensschutz gehört auch dazu, dass wir Menschen ermutigen, in schwierigen Situationen oder am Ende ihres Daseins nicht vorzeitig aufzugeben. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar festgestellt, dass jeder von uns zu allen Zeitpunkten seiner Existenz das Recht besitzt, über sein Leben selbst bestimmen zu können. Dennoch wurde auch klar: Wenngleich die gewerbsmäßige Sterbehilfe in Deutschland nicht gänzlich verboten werden kann, so darf sie gemäß der Höchstrichter doch unter Bedingungen gestellt werden. Und nach meiner festen Überzeugung bedarf es dieser abfedernden Voraussetzungen, wie sie auch beim Schwangerschaftsabbruch in den Prozess der Willensentscheidung eingebaut wurden. Der Gesetzgeber sollte bei jedem Wunsch, Sterbehilfe in Anspruch nehmen zu wollen, eine mehrstufige Beratung als Notwendigkeit vorsehen, ehe ein Arzt, ein Non-Profit-Verein oder ein Angehöriger passiv dazu beitragen kann, dass ein Mensch sein Leben vorzeitig beendet. Denn wie oft kommt es vor, dass psychische Notsituationen zu einem Überdruss führen und Lebensfreude verlorengeht – solch ein Zustand aber nur temporär ist und nicht selten mit einfachen Interventionen entsprechend abgemildert werden kann. Wollen wir also einen 30-Jährigen in tiefer Depression einfach so ziehen lassen? Und selbst der 80-Jährige im Endstadium seiner Krebserkrankung kann heute durch Schmerz- und Palliativmedizin einen würdevollen Abschied von seinem Leben nehmen, ohne es vorzeitig beenden zu müssen.
Klar ist aber auch: Der Entschluss obliegt letztendlich jedem Einzelnen ganz allein. Es wäre übergriffig, würden wir jemanden zum Hierbleiben drängen und überreden wollen, der nach reiflicher Überlegung, mehrfacher Konsultation von Ärzten, psychologischen Fachkräften und der Abwägung aller Umstände des persönlichen Leids zu der Überzeugung kommt, in seinem Zustand nicht mehr weiterleben zu wollen. Denn es zählt die subjektive Empfindung, den individuellen Lebenswert kann nur der Betroffene selbst bemessen – deshalb ist das ureigene Befinden über den inhärenten Lebenssinn auch keine Verhandlungsmasse. Es geht nicht darum, mit einem Betroffenen darüber zu diskutieren, ob Sterbehilfe in seinem Fall richtig, angemessen oder nachvollziehbar ist. Viel eher sehe ich die Aufgabe des Lebensschutzes in einer transparenten, aber ergebnisoffenen Darlegung aller Optionen darüber, welche Unterstützung auch in scheinbar ausweglosen Situationen noch denkbar ist. Nein, ich will mir nicht anmuten, jemanden zum irdischen Verbleiben zu überreden. Und doch weiß ich, dass die Pein von endloser Krankheit und stillem Siechen vielen Menschen nicht mehr würdig erscheint. Diese Feststellung habe ich zu respektieren – wenngleich ich mir wünschen würde, jeden meiner Nächsten in solch einer Lage von seiner Qual erretten zu können, ohne ihn dabei in die Ewigkeit gehen zu lassen. Wir brauchen eine Stärkung der Palliativmedizin und der Psychoonkologie, aber auch ein Netz an fachlichen Beratern, die befinden können, ob eine Sehnsucht nach dem Abschied bei klarem Verstand und von psychischer Dekompensation unbeeinflusst geäußert wird.
Insgesamt bleibt mein Einsatz für das Leben von der tiefen Überzeugung getragen, dass wir höchst intime und immanente Entschlüsse, sei es nun zur Beendigung einer Schwangerschaft oder des eigenen Daseins, mit Anerkennung begegnen sollten. Daher bin ich auch keinesfalls für ein Schwarz-Weiß-Denken aus Verboten und erhobenem Zeigefinger zu haben, denn solch eine Anmaßung steht uns nicht zu. Viel eher sehe ich es als meine Aufgabe, einen Ethos der Würde für kommendes und bestehendes Leben zu verteidigen. Ich sehe mich damit auf dem Boden unserer Verfassung und eines christlichen Verständnisses, das es nach meiner Auffassung gerade in der transhumanistischen Zeit zu schützen gilt.
Wichtige Hinweise:
Falls Sie sich in einem Schwangerschaftskonflikt befinden, wenden Sie sich beispielsweise an folgende Adresse: www.alfa-ev.de.
Sofern Sie in einer psychischen Notsituation sind, melden Sie sich zum Beispiel bei der „Telefonseelsorge“ über 0800 / 111 0 111 oder 0800 / 111 0 222.
Philosophischer Laienarbeitskreis
Liebe Besucher!
Sie gilt sicherlich als die am häufigsten gestellte Frage der Menschheit überhaupt: „Sein oder Nichtsein?“ aus Shakespeares Tragödie „Hamlet“. Und eine generelle Antwort wird man auf sie auch nicht finden. Doch genau darin gründet sich ja auch ihr Geheimnis – wie in den vielen anderen Rätseln des Lebens, die uns jeden Tag befassen. Und ehrlicherweise müssen wird doch dankbar dafür sein, dass nicht jede Lösung sofort parat liegt. Was wäre es doch für ein einfallsloses Existieren, wenn es keine kniffligen Aufgaben gäbe, mit denen wir unsere Hirnwindungen in Schach halten können! Das Streben nach neuen Einsichten, Erklärungen und Beschreibungen ist ein wesentlicher Motor dafür, unser Zugegensein ständig neu zu vitalisieren und es spannend, herausfordernd und abwechslungsreich zu machen.
Diese Auffassung hatten wohl auch unsere „großen“ Vorfahren wie Aristoteles, Platon, Sokrates oder Epikur, als sie sich bemühten, Weltliches und Überirdisches zu deuten und daraus Konsequenzen für das Verständnis des Universums abzuleiten. Wenn sie sich an die Erkundung des „Warums“ machten, nach dem „Wie“ forschten oder das „Wohin“ erleuchten wollten, trugen sie damit nicht nur zur Aufklärung bei, sondern weckten den natürlichen Drang von uns zivilisierten Lebewesen nach Gewissheit. Man möge an dieser Stelle sagen: „Gott sei Dank, dass der Weg das Ziel ist!“. Denn auch wenn wir am Ende glücklich und erleichtert sind, den Schatz in den Händen zu halten, wäre diese Erfahrung der Freude ohne das vorangegangene Erlebnis der Suche doch gleichsam nur halb so schön!
Allerdings befriedigt es keinesfalls die kognitive Sehnsucht nach Wirklichkeit, wenn wir die objektive Realität verstehen. Stattdessen bringt die Auseinandersetzung mit Eventualitäten, die in unserem Obwalten bis heute fortbestehen und uns innerlich kitzeln, ganz wesentliche immaterielle Kostbarkeiten zutage. Sie können uns schlussendlich dabei helfen, eine individuelle und persönliche Ideologie zu kreieren – oder uns einer bestehenden Weltsicht zuzuordnen, was nicht zuletzt rationale Identität stiftet und uns erdet. Insofern ist Philosophie trotz ihres Rufs als tröge, langweilige und bisweilen nutzlose Disziplin ganz elementar für unsere Personifikation und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Selbst wenn sie in einer Zeit, in der Effizienz vor allem an Zahlen und Fakten gemessen wird, einen eher unscheinbaren und auf den ersten Blick entbehrlichen Beitrag für ein transhumanistisches Gefüge leistet, wird ihre Bedeutung schon allein daran fassbar, dass sie Normen und Werte formt – und damit großen Anteil an einem friedlichem Miteinander hat.
Philosophieren kann also einerseits ein erfüllendes Hobby sein, weil wir uns ein Bewusstsein für Komplexe schaffen, welche im Alltag selbstverständlich sind und deshalb aus unserer Aufmerksamkeit herausfallen. Andererseits hat die Beschäftigung mit den unbegreiflichen Dingen aber auch einen zivilisatorischen Mehrwert: Würden wir uns nicht der metaphysischen Crux widmen, bedeutete das einen Stillstand im evolutionären Entwicklungsfortschritt, der uns besonders in ethischer Hinsicht erheblich schaden könnte. Denn was die Christen als „Nächstenliebe“ bezeichnen, ist auch im nicht-gläubigen Kontext von Rang: Philanthropie gehört zum Kitt aller Gemeinschaft, ohne Tugend und Moral würde das menschliche Verhalten vollends dissozial verelenden. Das Einordnen unseres Handelns in einen sittlichen Kontext ist unverzichtbar für einen Kollektivismus der Demokratie und Solidarität. So kommt der Philosophie durchaus eine politische Verantwortung zu, da sie die theoretischen Eckpfeiler für eine freiheitliche Grundordnung liefert.
Schließlich bedarf es ihrer Förderung auch deshalb, weil sie Regeln und Maßstäbe setzt. Sie sind Ausdruck von oftmals Jahrzehnte andauernden Prozessen der Meinungsbildung und das Ergebnis von zusammenlaufenden Routen zwischen unseren Synapsen, die bei vielen Erörterungen ins Dilemma führen – weil wir durch unsere menschliche Vernunft begrenzt sind. Trotzdem lohnt sich die Auseinandersetzung auch mit schwierigen Konstellationen, obwohl der Wunsch nach Logik und Zusammenhängen nicht selten von der Unendlichkeit der potenziellen Resultate durchkreuzt wird. Gleichermaßen haben es uns viele Philosophen vorgemacht: Auch wenn manch dialektische Kontroverse über unsere diesseitige Präsenz aufgrund der unzähligen Möglichkeiten und Ausgänge frustran verlaufen kann, lohnt sich das Festhalten an der Vision, das Ineinandergreifen der Zahnräder des Zufalls prosaisch erfassen zu können. Deshalb haben wir unseren Kreis gegründet, um gemeinsam an der Entschlüsselung des Schicksals mitwirken zu können. Und selbst wenn sich dieses Anliegen visionär oder gar utopisch anhören mag, so ist es genau das Wesen der Philosophie.
Ausdrücklich privilegieren oder benachteiligen wir keine einzige der philosophischen Strömungen. Uns ist es wichtig, andere Meinungen und Auffassungen nicht zu bewerten, sondern sie in unserem eigenen Interesse zu reflektieren – damit wir aus den Überlegungen des Gegenübers profitieren, lernen und wachsen können. Die Unterschiedlichkeit der Perspektiven sehen wir als Bereicherung an, denn die Dynamik des Denkens verschiedener Köpfe trägt unmittelbar zur Qualität und Fruchtbarkeit des Outputs bei. Daher möge sich jegliche Couleur bei uns wohlfühlen und dazugehören.
Wir beschäftigen uns beispielsweise mit folgenden Themen:
- Wozu leben wir eigentlich?
- Welchen Zweck erfüllt der Kosmos?
- Wo war der Anfang – und wo ist das Ende?
- Bedingen wir einander trotz des freien Willens?
- Hat unser Dasein überhaupt einen Sinn?
- Ist es gut, dass es die Endlichkeit gibt?
- Bringt Hoffnung Enttäuschung oder Mut?
- Was ist rechtens, wenn es ungerecht wird?
- Gibt es einen Gott? Und wenn ja, wofür brauchen wir ihn?
- „Nun sag‘, wie hast du’s mit der Religion?“ – Gretchenfrage aus „Faust“
- Wie handeln wir „richtig“ – und in welchem Sinne sollte es sein?
- Welche Rolle nimmt der Mensch im Bauwerk der Welt ein?
- Wie gehen wir mit der Endlichkeit von Verstand und Tatsächlichkeit um?
etc.
Wir sehen unsere Aufgaben im Folgenden definiert:
- Förderung des philosophischen Dialogs unter Laien
- Formulierung von Antworten auf Fragen der Zeit
- Herausgabe von Stellungnahmen zu aktuellen Themen
- Anregung zum öffentlich-konstruktiven Streitgespräch über die Gegenwart
- Beratung in ethisch-moralischen Fragestellungen
- Moralische Einschätzung zu politischen und rechtlichen Entscheidungen
- Beiträge zum interkulturellen Dialog der Weltanschauungen
usw.
Bei uns kann jeder mitmachen! Wir freuen uns über alle Menschen, die mit Neugier, Interesse und Begeisterung am Philosophieren ihre Gedanken, Mysterien und Glaubenssätze mit uns teilen. Dabei scheuen wir uns nicht vor strittigen Punkten – ganz im Gegenteil! Unser Ziel ist es nicht, auf jedes Sujet ein Ergebnis zu finden. Stattdessen ist der Erkenntnisgewinn des Diskurses bereits Bereicherung genug. Und selbstverständlich können bei uns auch erfahrene und studierte Philosophen mit einsteigen. Dennoch wollen wir im gemeinsamen Interesse darauf achten, vorrangig praxisnah und weniger wissenschaftlich zu debattieren, um die Chance zur Teilhabe möglichst breit offenzuhalten und unseren Kreis nicht durch intellektuelle Höhenflüge abzuschotten.
Möchten also auch Sie dabei sein, ganz unverbindlich, punktuell oder regelmäßig? Es kostet nichts und niemand verpflichtet sich. Denn wir sind ein loser Zusammenschluss, in dem Fluktuation nicht ausgeschlossen ist, der aber gleichsam auf Beständigkeit ausgerichtet sein soll.
Wir kommunizieren vorrangig über die elektronischen Medien und sind daher örtlich wie zeitlich unabhängig. Somit ist garantiert, dass Teilnehmer aus ganz Deutschland bei uns partizipieren können.
Melden Sie sich bei uns und lernen Sie uns kennen!
Herzliche Grüße
Dennis Riehle